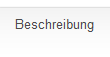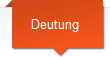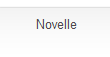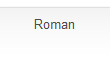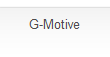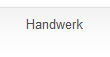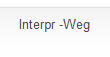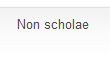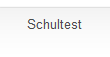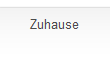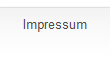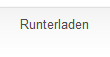|
|
|
|
|
Gedichtvergleich „Ebenbild“ (Gryphius) – „Wandersmann“ (Eichendorff)
Andreas Gryphius Ebenbild unseres Lebens Auf das gewöhnliche Königs-Spiel
Der Mensch, das Spiel der Zeit, spielt weil er allhie lebt, Im Schauplatz dieser Welt; er sitzt, und doch nicht feste. Der steigt und jener fällt, der suchet die Paläste Und der ein schlechtes Dach, der herrscht und jener webt.
Was gestern war ist hin, was itzt das Glück erhebt, Wird morgen untergehn, die vorhin grünen Äste Sind nunmehr dürr und tot, wir Armen sind nur Gäste, Ob den ein scharfes Schwert an zarter Seide schwebt.
Wir sind zwar gleich am Fleisch, doch nicht von gleichem Stande. Der trägt ein Purpurkleid, und jener gräbt im Sande, Bis nach entraubtem Schmuck der Tod uns gleiche macht.
Spielt denn dies ernste Spiel: weil es die Zeit noch leidet Und lernt: daß wenn man vom Pauket des Lebens scheidet: Krön, Weisheit, Stärk und Gut bleibt ein geborgter Pracht.
Im Folgenden werde ich das Gedicht „Ebenbild unseres Lebens“ von Andreas Gryphius analysieren und interpretieren und anschließend verdeutlichen, inwieweit dieses Gedicht in Inhalt und formaler Gestaltung charakteristisch für die Epoche ist. In dem Sonett „Ebenbild unseres Lebens“ vergleicht der Autor Andreas Gryphius das menschliche Leben mit dem Schachspiel, um deutlich zu machen, dass jeder Mensch auf der Erde eine bestimmte, von Gott zugewiesene Rolle zu spielen hat. Er erinnert den Leser aber gleichzeitig daran, dass am Ende des Lebens alle weltlichen Werte nichtig geworden sind und jeder vor Gott treten muss, um von ihm gerichtet zu werden. Das Gedicht enthält daher implizit die Aufforderung an den Leser, er solle die ihm zugewiesene Rolle gut erfüllen, um am Ende in Gottes Reich gelangen zu können. Das Sonett „Ebenbild unseres Lebens“, das sich formal in zwei Quartette und zwei Terzette gliedern lässt, beginnt mit allgemeinen Feststellungen über das Leben des Menschen auf Erden. Der Mensch wird in einem metaphorischen Vergleich als „Spiel der Zeit“ bezeichnet und es wird von ihm gesagt, dass er die ganze Zeit, die er „allhie“ war, also auf der Erde, verbringe, spiele (I, 1). Die Metapher „Spiel der Zeit“ macht eine gewisse Hilflosigkeit des Menschen deutlich: Er ist lediglich ein „Spielzeug“ der Zeit, kann sich also gegen die Zeit nicht wehren und muss sich mit dem ihm zugeteilten Leben abfinden. Auch der zweite Vers wird mit einer Metapher eingeleitet, indem die Welt als ein Schauplatz dargestellt wird, in dem Mensch „sitze“, aber „doch nicht feste“. Der Vergleich der Welt mit einem Schauplatz führt bereits zu im zweiten Quartett auch deutlicher herausgearbeiteten Vanitasmotivik des Gedichts hin, denn mit dem Begriff „Schauplatz“ assoziiert der Leser den Bereich der Bühne, des Schauspiels. Hier deutet sich also bereits an, dass das Leben bzw. die Welt nur als ein begrenztes Schauspiel gesehen wird, das zwangsläufig durch den Tod beendet werden muss. Im dritten und vierten Vers wird man auf die unterschiedliche Lebenssituation der einzelnen Menschen in antithetischer Gegenüberstellung eingegangen: Der eine steige, ein anderer falle, der eine suche die Paläste, ein anderer ein schlechtes Dach, einer herrsche, ein anderer wiederum müsse weben (I, 3 und 4). Die antithetische Gegenüberstellung von „der suchet die Paläste“ (I,3) und „Und der ein schlechtes Dach“ (I,4) erfolgt über das Zeilenende hinaus durch ein Enjambement, wodurch Vers drei und vier der ersten Strophe zu einer Sinneinheit verschmelzen. Inhaltlich veranschaulichen beide Verse, dass jeder Mensch ein anderes Leben führt bzw. zu führen hat: Die einen sind dazu bestimmt, in Palästen zu wohnen und zu herrschen, während die anderen unter einem schlechten Dach leben und weben müssen. Die zweite Strophe isst von Antithesen geprägt, wobei diese stets über das Zeilenende hinausgehen, um die zweite Strophe deutlich als eine inhaltliche Einheit erscheine zu lassen. ES wird hier die bereits der in Strophe eins angedeutete Vanitasgedanke („Schauplatz“) ausgeführt: Es wird gesagt, dass das, was jetzt durch das Glück erhoben werde, bereits morgen untergehe (II, 1 und 2). Dieser Gedanke der Vergänglichkeit wird durch seinen bildlichen Vergleich aus der Natur nochmals verdeutlicht, indem gesagt wird, dass die vorhin noch grünen Äste nunmehr dürr und tot seinen (II, 2 und 3). Im folgenden wird der Vanitasgedanke nun konkret auf den Menschen angewendet, indem von ihm behauptet wird, er sei nur ein Gast auf Erden (II,3), „ob den ein scharfes Schwert an zarter Seide schwebt“ (II,4) (Damokles-Schwert; We) Auffällig ist, dass im dritten Vers der zweiten Strophe erstmals sein lyrisches Ich in Erscheinung tritt: „wir Armen sind nur Gäste“ (II,3). Das Wort „wir“ macht deutlich, dass sich der Sprecher in die Aussage mit einbezieht, dass er die gemachten Aussagen als auch für sich und sein Leben zutreffend versteht. Das in Vers vier erwähnte Schwert soll vermutlich deutlich machen, dass Gott letztendlich über den Menschen richtet („Richterschwert“). Durch die Verbindung des Begriffs „Schwert“ mit „zarter Seide“ wird herausgestellt, dass das Schwert nur schwach befestigt bzw. der Lebensfaden dünn ist und Gottes Urteilsspruch den Menschen daher jederzeit mit seiner ganzen Wucht treffen kann. Das erste der beiden nun folgenden Terzette wird wieder durch eine Aussage des lyrischen Ichs, in die er sich selbst mit einbezieht, eingeleitest: Es wird gesagt, dass die Menschen zwar gleich an Fleisch seine, aber nicht von gleichem Standen (II,1). Im zweiten Vers wird ausgeführt, wie sich dieser Standesunterschied äußerlich bemerkbar macht. Der eine trage ein Purpurkleid, während der andere im Sande grabe (III,2). Es liegt hier abermals ein klar antithetischer Aufbau vor. Im dritten Vers kommt aber nun ein entscheidender Aspekt in Hinblick auf die Aussage des Gedichts hinzu. Dort heißt es nämlich, dass nach entraubtem Schmuck der Tod alle gleich macht. Dies beinhaltet zum einen die Aussage, dass der Tod letztendlich jeden Schmuck und alle weltlichen Güter nutzbar mache, sie also von einem nehme. Zum anderen wird aber auch darauf hingewiesen, dass nach dem Tod alle Menschen gleich sind, also ohne Standesunterschied vor Gott treten. Die letzte Strophe richtet sich nun mit einem direkten Appell an den Leser. Er solle das ernste Spiel (des Lebens) spielen, solange es die Zeit leide, also solange er auf Erden ist (IV, 1). Im zweiten Vers fordert das lyrische Ich den Leser dann direkt auf, folgendes zu lernen, dass, wenn man vom Festmahl des Lebens scheide, also wenn man sterbe, „Kron, Weisheit, Stärk und Gut“ doch nur eine geborgte Pracht gewesen seien. Das letzte Terzett beinhaltet somit auch die Hauptaussage des Gedichts: Der Mensch solle die ihm zugewiesene Rolle nach bestem Wissen und Gewissen spielen. Es wird deutlich, dass diese Rolle auch dann keine schlechte ist, wenn sie mit Entbehrungen und Leid verbunden ist, denn in Vers zwei der vierten Strophe wird das Leben in einem metaphorischen Vergleich als „Festmahl“ bezeichnet. In der letzten Strophe tritt aber auch der Vanitasgedanke wieder deutlich zu Tage, denn es werden alle materiellen Werte (Kron) und auch ideellen Werte (Weisheit, Stärke) als geborgte Pracht bezeichnet. Das lyrische Ich macht dadurch klar, dass diese Werte über den Tod hinaus keinen Bestand haben. Es liegt somit auch eine implizite Warnung an den Leser bzw. die Menschen allgemein vor, sie sollten nicht zu sehr nach diesen weltlichen und somit auch vergänglichen Werten streben, weil dies gleichzeitig eine Gefahr für ihr Seelenheil in sich berge. Zur Überschrift lässt sich abschließend feststellen, dass sie die Aussage insofern unterstütz, als das Schachspiel als ein Ebenbild unseres Lebens gesehen wird. Dieser Vergleich ist sehr treffend, da auch beim Schach jeder Figur (übertragen: jedem Menschen) eine gewisse Rolle vom Spieler (übertragen: von Gott) zugeteilt wird, die dieser Figur dann möglichst gut zu erfüllen hast. Eine weitere Parallele lässt sich ziehen: Das Gedicht beinhaltet die Aussage, das nach dem Tod alle Menschen gleich sind. Dies ist beim Schachspiel in gewisser Weise auch der Fall, denn die „toten“ (geschlagenen) Figuren sind untereinander alle gleich, da sie das gleiche „Schicksal“ erlitten haben. Das Gedicht „Ebenbild unseres Lebens“ ist insofern charakteristisch für die Epoche des Barock, als es vom formalen Aufbau her dem Idealtyp des Sonetts entspricht: Gryphius verwendet einen Alexandriner mit Zäsur als Metrum, gliedert das Gedicht in zwei Quartette und zwei Terzette, und das Reimsschema ist abba abba ccd eed. Ein weiters typisches Merkmal ist die starke Antithetik, wobei Gryphius hier variabel ist, indem er häufig Enjambements verwendet, um die gegeneinander gestellten Begriffe in Beziehung zueinander zu bringe (z.B. 2. Strophe – Enjambement zwischen Vers eins und zwei und Vers zwei und drei). Weiterhin ist der dialogische Aufbau des Gedichts auffällig: Der Leser wird angesprochen, und der Sprecher, das lyrische Ich, bezieht sich in die gemachten Aussagen mit ein (vgl.: 2.Strophe, 1.Vers). Das Gedicht gipfelt in einem für barocke Lyrik typischen Appell an den Leser (IV, 1: „Und lernt: …“. Es lässt sich folglich auch eine barocke Finalstruktur erkennen: Das Gedicht führt von allgemeinen Beobachtungen über die unterschiedlichen Lebensverhältnisse der Menschen (erste Strophe) über eine durch Metaphern veranschaulichte Motivik der Vergänglichkeit (zweite Strophe) zum konkreten Appell an den Leser in den Terzetten: Er verändert das „Rollenmotiv“, da das Denken der damaligen Zeit insofern wiedergibt, als es den Leser darauf aufmerksam zu machen versucht, dass jeder Mensch auf Erden eine von Gott zugewiesene Rolle zu spielen hat und am Ende seines Lebens je nach Erfüllung dieser Aufgabe über ihn gerichtet wird. Diese Denkhaltung erklärt auch, warum sich in dem Gedicht keine Kritik an der hierarchischen Ordnung der damaligen Zeit finden lässt, denn man verstand diese Ordnung als eine von Gott gegebene. Des Weiteren verwendet Gryphius das Vanitasmotiv. Er weist den Leser darauf hin, dass alles vergänglich ist (besonders deutlich in Strophe 2). Und appelliert somit gleichzeitig, wenn auch unterschwellig, an den Leser, er solle nicht zu sehr nach weltlichen Gütern streben, da diese nach seinem Tod sowieso ihren Wert verlieren und daher auch eine gewisse Gefährdung für das Seelenheil des Menschen darstellen. Die angeführten Aspekte machen deutlich, dass es sich bei dem Sonett um ein typisches Barockgedicht handelt, das mir insofern gut gefallen hat, als es den Gedanken des „Rollenspiels“ des Menschen und den der Vergänglichkeit (Vanitas) geschickt miteinander verbindet und so zu einer komplexen Gesamtaussage gelangt.
Aufgabe 2: Im Folgenden werde ich das Sonett „Ebenbild unseres Lebens“ von Gryphius mit dem Text „Der frohe Wandersmann“ von Joseph von Eichendorff vergleichen und herausarbeiten, wie das lyrische Ich bei Eichendorff die Rolle des Menschen auf Erden sieht. Joseph von Eichendorff Der frohe Wandersmann Wem Gott will rechte Gunst erweisen, Den schickt er in die weite Welt; Dem will er seine Wunder weisen In Berg und Wald und Strom und Feld.
Die Trägen, die zu Hause liegen, Erquicket nicht das Morgenrot, Sie wissen nur von Kinderwiegen, Von Sorgen, Last und Not um Brot. Die Bächlein von den Bergen springen, Die Lerchen schwirren hoch vor Lust, Was sollt ich nicht mit ihnen singen Aus voller Kehl und frischer Brust? Den lieben Gott lass ich nur walten; Der Bächlein, Lerchen. Wald und Feld Und Erd und Himmel will erhalten, Hat auch mein Sach aufs best bestellt!
Der Text „Der frohe Wandersmann“ handelt von einem lyrischen Ich, das in die Welt hinziehen will und dabei auf Gott vertraut, dass er immer den rechten Weg weisen wird. Der Text gliedert sich in vier Strophen à vier Versen, wobei ein Kreuzreim als Reimschema Verwendung findet. In der ersten Strophe wird die Überzeugung des lyrischen Ichs deutlich, dass Gott denjenigen, dem er seine Gunst erweisen will, in die weite Welt hinausschicke, damit er Gottes Wunder, nämlich die Natur (anschaulich dargestellt durch die Akkumulation „Berg, Wald, Strom und Feld“) sehe. In der zweiten Strophe der zu Hause Gebliebenen thematisiert und negativ gezeichnet. Es wird gesagt, dass diese ‚Trägen’ nicht durch das Morgenrot erquickt wurden und nur von den schlechten Dingen des Lebens (Parallele zur ersten Strophe: wieder eine Akkumulation – Sorgen, Last, Not um Brot) wüssten. In der dritten Strophe wird die Natur mit ihren Bächen und singenden Vögeln aufgerufen und das lyrische Ich stellt am Ende der Strophe die rhetorische Frage, warum es nicht mit den Vögeln singen solle. In der letzten Strophe zeigt sich dann deutlich die Beziehung des lyrischen Ichs zu Gott! Dor heißt es, dass es Gott walten lassen wolle, da dieser ja auch die Natur erhalte und somit auch seine „Sach aufs best bestellt“ habe. Vergleicht man den Text von Eichendorff mit dem Sonett von Gryphius, so fällt auf, dass sie sich bereits in ihrer äußeren Form unterscheiden. Eichendorff verwendet als Metrum zwar auch einen Jambus, es ist allerdings kein Alexandriner und er besitzt folglich auch keine Zäsur. Es lässt sich daher bei Eichendorff im Gegensatz zu Gryphius innerhalb der Strophen auch keine Antithetik finden. Die ‚Antithetik’ bei Eichendorff Besteht lediglich zwischen der zweiten Strophe und dem „Rest“ des Textes, denn in ihr wird das Leben der Trägen, die zu Hause geblieben sind, beschreiben, während die anderen Strophen eine Darstellung der Natur bzw. des die Natur erforschenden Menschen liefern. Dies deutet gleichzeitig auf ein unterschiedliches Rollenverständnis des Menschen bei Gryphius und Eichendorff hin. Während Gryphius die Aufgabe des Menschen auf Erden darin sieht, dass er die von Gott zugewiesene Rolle möglichst gut spielt und sein ganzer Lebenslauf dadurch in gewisser Weise vorgezeichnet ist, hat Eichendorff in dieser Beziehung eine ganz konträre Ansicht: Er sucht in dem Menschen ein Individuum, das seinen eigenen Weg geht, sein eigenes Glück sucht. Es steht in der Macht des Menschen, welche Rolle er sich selbst zuteilt. Ein weiterer Unterschied in der Auffassung Gryphius’ und Eichendorffs besteht darin, dass Gryphius’ Sonett letztendlich auch die Warnung enthält, man dürfe sich nicht zu sehr von der zugewiesenen Rolle entfernen und nach weltlichem Ruhm und weltllichen Gütern streben, da dies auch eine Gefahr für das Seelenheil bedeutete und eine Strafe v on Gott nach sich ziehe (vgl.: Gryphius, 2.Strophe, 4.Vers: „… an zarter Seide schwebt“). Gott wird bei Gryphius also auch als eine Bedrohung empfunden, denn er richtet über die Menschen und wird sie ihren Taten entsprechend belohnen bzw. bestrafen. Eichendorff legt hier eine weitaus freiere Haltung an den Tag. In der letzten Strophe des Textes wird nämlich klar ersichtlich, dass das lyrische Ich auf Gott vertraut (IV, 4: „Hat auch mein Sach aufs best bestellt!“) Gott wird also in keinster Weise als bedrohlich empfunden, sondern als jemand gesehen, auf den man sich verlassen kann, der einem den rechten Weg schon weisen wird. Es lassen sich mehrere für die Epoche der Romantik typische Merkmale an Eichendorffs Text veranschaulichen: Zum einen trat in der Romantik das Individuum mit seinen Empfindungen und Gefühlen in den Vordergrund. Der Mensch suchte die Nähe zu Gott, indem er in die von Gott erschaffene Natur hinauswanderte, wie es das lyrische Ich in Eichendorffs Text tut. Dieser Zug zur Natur war z.T. Reaktion auf die zu Beginn des 19. Jahrhunderts einsetzende Entfremdung des Menschen durch die Industrialisierung. Typisch für die Romantik ist, dass das lyrische Ich, das in die Natur hinauswandert, im Singen der Vögel und Plätschern der Bäche (dritte Strophe) Gottes Nähe zu spüren glaubt und daher zu der in der 4. Strophe deutlich werdenden Schlussfolgerung kommt, Gott werde ihm den rechten Weg weisen. Die Natur ist dem lyrischen Ich also ein beweis für Gottes Nähe und stärkt somit sein Vertrauen zu Gott. Bei dem Text „Der frohe Wandersmann“ handelt es sich außerdem um eine Rollengedicht, denn das Gedicht entstammt der Novelle „Aus dem Leben eines Taugenichts“. Auch dies ist typisch für die Romantik: Gedichte erscheinen nicht mehr isoliert, sondern werden in eine Rahmenhandlung eingebunden, indem sie z.B. vom Helden des Prosatextes gesungen oder gesprochen werden. In der Romantik fand eine weitgehende Verwischung der Grenzen zwischen Lyrik, Drama und Epik statt. Außerdem wird anhand von Eichendorffs Text deutlich, dass das Leben derjenigen, die zu Hause bleiben und das Leben eines Philisters führen, als negativ betrachtet wird (2. Strophe). Im Sinne der Romantiker bestand eine „richtiges Leben“ darin, seinen Leidenschaften und Trieben in einem gewissen Grade nachzugeben, ohne aber völlig in ein gottloses Leben abzugleiten. Somit beinhaltet auch Eichendorffs Text einen Appell an den Leser, wenn auch der Aufbau und die Form nicht so dialogisch sind wie bei Gryphius. Bei Eichendorff wird der Leser indirekt dazu aufgefordert, dem lyrischen Ich nachzuahmen und ebenfalls in die Natur hinauszugehen.
Kommentar: Eine sprachlich ansprechend formulierte, gedanklich klar gegliederte Klausur, in der alle wesentlichen Aspekte berührt werden. Erfreulich ist auch der Nachweis der Epochenkenntnisse. (14 Pkt) Michael Kutz © Gymnasium Bad Essen LK 12/ 1993 (S. Wiese)
|
|
|
|