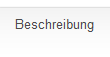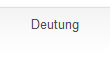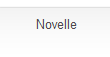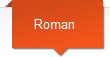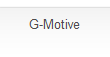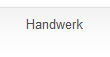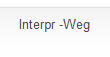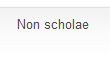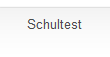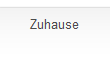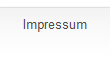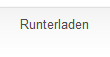|
|
|
|
|
Romantypologie - Romantyp Zeit
Gegenwartsroman Klaus Modick: Der Bestseller Gesellschaftsroman Eduard Keyserling: Wellen Gelehrtenroman Dunkelmännerbriefe s. Ich-Erzähler: Satire Großstadtroman Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz Rainer M.Rilke: Malte Laurids Brigge (Tagebuchroman) Heimat (Dorf-) Ganghofer: Waldrausch Historischer Roman Felix Dahn: Kampf um Roms (Gelehrtenroman) Kriegsroman: Erich Maria Remarque: Im Westen nichts Neues Schlüsselroman Reventlow: Herrn Dames Aufzeichnungen (Tagebuchroman) Utopieroman Insel Felsenburg s. Robinsonade (Abenteuer) und Ich-Erzähler
Gegenwartsroman Klaus Modick (* 1951) : Der Bestseller (Textauszug s. www.lyrikwelt.de) Uwe Tellkamp (* 1968): Der Schlaf in den Uhren (Lesehilfe) - Der Rosenkavalier (Geleit)
Gesellschaftsroman (s. a. Schlüsselroman) Eduard Keyserling (1855 – 1918) Wellen. Roman Die Generalin von Palikow und Fräulein Malwine Bork, ihre langjährige Gesellschafterin und Freundin, kamen in das Wohnzimmer. Sie wollten sich ein wenig erholen. Die Generalin setzte sich auf das Sofa, das frisch mit einem blanken, schwarz und roten Kattun bezogen war. Sie war sehr erhitzt und löste die Haubenbänder unterm Kinn. Das lila Sommerkleid knisterte leicht, die weißen Haarkuchen an den Schläfen waren verschoben und sie atmete stark. Sie schwieg eine Weile und schaute mit den ein wenig hervorstehenden grellblauen Augen kritisch im Zimmer umher. Das Zimmer war weiß getüncht, wenig schwere Möbel standen an den Wänden umher und über die Bretter des Fußbodens war Sand gestreut, der in der Abendsonne glitzerte. Es roch hier nach Kalk und Seemoos. »Hart«, sagte die Generalin und legte ihre Hand auf das Sofa. Fräulein Bork neigte den Kopf mit dem leicht ergrauten Haar auf die linke Schulter, blickte schief durch die Gläser ihres Kneifers auf die Generalin, und das bräunliche Gesicht, das aussah wie das Gesicht eines klugen älteren Herrn, lächelte ein nachdenkliches, verzeihendes Lächeln. »Das Sofa«, sagte sie, »natürlich, aber man kann es nicht anders verlangen. Für die Verhältnisse ist es doch sehr gut.« »Liebe Malwine«, meinte die Generalin, »Sie haben die Angewohnheit, alles gegen mich zu verteidigen. Ich greife das Sofa gar nicht an, ich sage nur, es ist hart, das wird man doch noch dürfen.« Fräulein Bork erwiderte darauf nichts, sie lächelte ihr verzeihendes Lächeln und schaute schief durch ihren Kneifer jetzt zum Fenster hinaus auf den kleinen Garten, der davor lag. Salat und Kohl wuchsen dort recht kümmerlich, Sonnenblumen standen da mit großen schwarzen Herzen, und über alledem lag ein leichter blonder Staubschleier. Dahinter der Strand grell orange in der Abendsonne, endlich das Meer undeutlich von all dem unruhigen Glänze, der auf ihm schwamm, von den zwei regelmäßigen weißen Strichen der Brandungswellen umsäumt. Und ein Rauschen kam herüber, eintönig, wie von einem schläfrigen Taktstock geleitet. Die Generalin hatte den Bullenkrug für den Sommer gemietet, um hier an der See ihre Familie um sich zu versammeln. Vor drei Tagen war sie mit Fräulein Bork, Frau Klinke, der Mamsell, und Ernestine, dem kleinen Dienstmädchen, hier angelangt, um alles einzurichten. Es erforderte Arbeit und Nachdenken genug, für alle diese Menschen Platz zu schaffen und nicht nur Platz, »denn«, pflegte die Generalin zu sagen, »ich kenne meine Kinder, bei allem, was ich gebe, sind sie kritisch wie ein Theaterpublikum.« Heute nun war die Tochter der Generalin, die Baronin von Buttlär, mit den Kindern, den beiden eben erwachsenen Mädchen Lolo und Nini und dem fünfzehnjährigen Wedig, angelangt. Der Baron Buttlär sollte nachkommen, sobald die Heuernte beendet war, und Lolos Bräutigam Hilmar von dem Hamm, Leutnant bei den Braunschweiger Husaren, wurde auch erwartet. »Werden sie auch heute abend alle satt werden?« begann die Generalin wieder. »Die Reise macht hungrig.« »Ich denke«, erwiderte Fräulein Bork, »da sind die Fische, die Kartoffeln, die Erdbeeren, und Wedig hat sein Beefsteak.« »So, so«, meinte die Generalin, »übrigens der Junge wird es im Leben nicht leicht haben, wenn er immer sein Beefsteak haben muß.« Fräulein Bork zuckte mit den Achseln und sagte entschuldigend: »Er ist so zart.« Aber das ärgerte die Generalin: »Gewiß, ich gönne ihm sein Beefsteak, Sie brauchen ihn nicht zu verteidigen. Nur finde ich, liebe Malwine, dass Sie keinen rechten Sinn haben für das, was man allgemeine Bemerkungen nennt.« Dann schwiegen die beiden Damen wieder. Draußen von der Holzveranda tönte Lärm herüber, Tellergeklapper und hohe Stimmen. Ernestine deckte dort den Tisch für das Abendessen und stritt dabei mit Wedig. Auch Lolo und Nini waren erschienen, sie lehnten an der Holzbrüstung der Veranda schmal und schlank in ihren blauen Sommerkleidern. Der Seewind fuhr ihnen in das leichte rote Haar und ließ es hübsch um die Gesichter mit den fast krank] feinen Zügen flattern. Die Mädchen zogen ein wenig die Augenbrauen zusammen und schauten mit den blanken braunroten Augen unverwandt auf das Meer und öffneten die Lippen, als wollten sie lächeln, aber das große bewegte Leuchten vor ihnen machte sie schwindelig. Auch Wedig hatte sich nun zu ihnen gesellt und schaute auch schweigend hinaus. Das kränkliche Knabengesicht verzog sich, als täte all dieses Licht ihm weh. »So«, sagte die Generalin drinnen zu Fräulein Bork, » das war ein angenehmer stiller Augenblick. Ich höre, meine Tochter kommt die Treppe herunter, nun kann es wieder losgehen.« Frau von Buttlär hatte ein wenig geschlafen, trug ihren Morgenrock und hüllte sich fröstelnd in ein wollenes Tuch. Sie mochte früher das hübsche überzarte Gesicht ihrer Töchter gehabt haben, jetzt waren die Wangen eingefallen und die Haut leicht vergilbt. Aufgebraucht von Mutterschaft und Hausfrauentum war sie sich ihres Rechtes bewußt, kränklich zu sein und nicht mehr viel auf ihr Äußeres zu geben. Man setzte sich auf der Veranda zur Abendmahlzeit nieder an den Tisch, über den das rote Abendlicht hinflutete und der Seewind an dem Tischtuch und den Servietten zerrte. Das machte die Gesellschaft schweigsam, so das Meer vor sich war es, als sei man nicht allein, nicht unter sich. »Ich habe mir das Meer größer gedacht«, erklärte Wedig endlich. »Natürlich, mein Sohn«, meinte die Generalin. »Du willst wohl für dich ein Extraeer.« Frau von Buttlär lächelte gerührt und sagte leise: »Er hat so viel Phantasie.« Fräulein Bork sah Wedig schief durch ihren Kneifer an und meinte: »An die Phantasie des Kind reicht selbst das Weltmeer nicht hinan.« Nun begann Frau von Buttlär mit ihrer Mutter ein Gesprach über Repenow, ihr Gut, über Dinge, die sie anzuordnen vergessen hatte, von Gemüsen, die eingemacht werde sollten, und Dienstboten, die unzuverlässig waren; lauter Sachen, die seltsam fremd und unpassend in das Rauschen des Meeres Meeres hineinklangen, dachte Lolo. Aber unten am Tisch war ein Streit entstanden zwischen Wedig und Ernestine.»Ernestine«, sagte Fräulein Bork streng, »wie oft habe ich es dir nicht gesagt, du darfst beim Servieren nicht sprechen.Oh! Cet enfant!« setzte sie hinzu und seufzte. Die Generalin lachte. »Ja, unsere Bork hat es mit Ernestines Erziehung schwer, denkt euch, heute mittag entschließt sich das Mädchen zu baden. Sie geht ins Meer nackt wie ein Finger, am hellen Mittag.« - »Aber Mama!« flüsterte Frau von Buttlär, die Mädchen beugten sich auf ihre Teller nieder, während Wedig nachdenklich Ernestine nachschaute, die kichernd verschwand. Das Abendlicht legte sich jetzt plötzlich ganz grellrot und unwahrscheinlich über den Tisch und Fräulein Bork schrie auf: »Seht doch!« Alle fuhren mit den Köpfen herum. An dem blaßblauen Himmel standen riesige kupferrote Wolken und auf dem dunkel- werdenden Meer schwamm es wie große Stücke rotglänzenden Metalls, während die am Ufer zergehenden Wellen den Sand wie mit rosa Musselintüchern überdeckten. Wedig blinzelte mit den roten Wimpern und verzog wieder sein Gesicht, als schmerzte es ihn. »Das ist allerdings rot«, meinte er. Die Generalin jedoch war unzufrieden: »Sie haben mich erschreckt, Malwine, Sie haben eine Art, auf Naturschönheiten aufmerksam zu machen, daß man jedes Mal zusammenfährt und glaubt, eine Wespe sitze einem irgendwo im Gesicht.« Die Mahlzeit war zu Ende, die Mädchen und Wedig stellten sich an die Veranda- brüstung, um auf das Meer zu starren. Frau von Buttlär hüllte sich fester in ihr Tuch und sprach mit leiser, besorgter Stimme von ihren häuslichen Angelegenheiten.
Großstadtroman
Alfred Döblin (1878 – 1957) : Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf - 1929 (kein copyright)
Rainer Maria Rilke (1875 . 1926) : Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (Tagebuchroman, 1910) 11. September, rue Toullier. So, also hierher kommen die Leute, um zu leben, ich würde eher meinen, es stürbe sich hier. Ich bin ausgewesen. Ich habe gesehen: Hospitäler. Ich habe einen Menschen gesehen, welcher schwankte und umsank. Die Leute versammelten sich um ihn, das ersparte mir den Rest. Ich habe eine schwangere Frau gesellen. Sie schob sich schwer an einer hohen, warmen Mauer entlang, nach der sie manchmal tastete, wie um sich zu überzeugen, ob sie noch da sei. Ja, sie war noch da. Dahinter? Ich suchte auf meinem Plan: Maison d'Accouchement. Gut. Man wird sie entbinden —man kann das. Weiter, rue Saint-Jacques, ein großes Gebäude mit einer Kuppel. Der Plan gab an Val-de-grâce, Hôpital militaire. Das brauchte ich eigentlich nicht zu wissen, aber es schadet nicht. Die Gasse begann von allen Seiten zu riechen. Es roch, soviel sich unterscheiden ließ, nach Jodoform, nach dem Fett von pommes frites, nach Angst. Alle Städte riechen im Sommer. Dann habe ich ein eigentümlich starblindes Haus gesehen, es war im Plan nicht zu finden, aber über der Tür stand noch ziemlich leserlich: Asyle de nuit. Neben dem Eingang waren die Preise. Ich habe sie gelesen. Es war nicht teuer. Und sonst? ein Kind in einein stehenden Kinderwagen: es war dick, grünlich und hatte einen deutlichen Ausschlag auf der Stirn. Er heilte offenbar ab und tat nicht weh. Das Kind schlief, der Mund war offen, atmete Jodoform, pommes frites, Angst. Das war nun mal so. Die Hauptsache war, daß man lebte. Das war die Hauptsache. DASS ich es nicht lassen kann, bei offenem Fenster zu schlafen. Elektrische Bahnen rasen läutend durch meine Stube. Automobile gehen über mich hin. Eine Tür fällt zu. Irgendwo klirrt eine Scheibe herunter, ich höre ihre großen Scherben lachen, die kleinen Splitter kichern. Dann plötzlich dumpfer, eingeschlossener Lärm von der anderen Seite, innen im Hause. Jemand steigt die Treppe. Kommt, kommt unaufhörlich. Ist da, ist lange da, geht vorbei. Und wieder die Straße. Ein Mädchen kreischt: Ah tais-toi, je ne veux plus. Die Elektrische rennt ganz erregt heran, darüber fort, fort über alles. Jemand ruft. Leute laufen, überholen sich. Ein Hund bellt. Was für eine Erleichterung: ein Hund. Gegen Morgen kräht sogar ein Hahn, und das ist Wohltun ohne Grenzen. Dann schlafe ich plötzlich ein. DAS sind die Geräusche. Aber es giebt hier etwas, was furchtbarer ist: die Stille. Ich glaube, bei großen Bränden tritt manchmal so ein Augenblick äußerster Spannung ein, die Wasserstrahlen fallen ab, die Feuerwehrleute klettern nicht mehr, niemand rührt sich. Lautlos schiebt sich ein schwarzes Gesimse vor oben, und eine hohe Mauer, hinter welcher das Feuer auffährt, neigt sich, lautlos. Alles steht und wartet mit hochgeschobenen Schultern, die Gesichter über die Augen zusammengezogen, auf den schrecklichen Schlag. So ist hier die Stille. ICH lerne sehen. Ich weiß nicht, woran es liegt, es geht alles tiefer in mich ein und bleibt nicht an der Stelle stehen, wo es sonst immer zu Ende war. Ich habe ein Inneres, von dem ich nicht wußte. Alles geht jetzt dorthin. Ich weiß nicht, was dort geschieht. Ich habe heute einen Briet geschrieben, dabei ist es mir aufgefallen, daß ich erst drei Wochen hier bin. Drei Wochen anderswo, auf dem Lande zum Beispiel, das konnte sein wie ein Tag, hier sind es Jahre. Ich will auch keinen Brief mehr schreiben. Wozu soll ich jemandem sagen, daß ich mich verändere? Wenn ich mich verändere, bleibe ich ja doch nicht der, der ich war, und bin ich etwas anderes als bisher, so ist klar, daß ich keine Bekannten habe. Und an fremde Leute, an Leute, die mich nicht kennen, kann ich unmöglich schreiben. HABE ich es schon gesagt? Ich lerne sehen. Ja, ich fange an. Es geht noch schlecht. Aber ich will meine Zeit ausnutzen. Daß es mir zum Beispiel niemals zum Bewußtsein gekommen ist, wieviel Gesichter es giebt. Es giebt eine Menge Menschen, aber noch viel mehr Gesichter, denn jeder hat mehrere. Da sind Leute, die tragen ein Gesicht jahrelang, natürlich nutzt es sich ab, es wird schmutzig, es bricht in den Falten, es weitet sich aus wie Handschuhe, die man auf der Reise getragen hat. Das sind sparsame, einfache Leute; sie wechseln es nicht, sie lassen es nicht einmal reinigen. Es sei gut genug, behaupten sie, und wer kann ihnen das Gegenteil nachweisen? Nun fragt es sich freilich, da sie mehrere Gesichter haben, was tun sie mit den ändern? Sie heben sie auf. Ihre Kinder sollen sie tragen. Aber es kommt auch vor, daß ihre Hunde damit ausgehen. Weshalb auch nicht? Gesicht ist Gesicht. Andere Leute setzen unheimlich schnell ihre Gesichter auf, eins nach dem ändern, und tragen sie ab. Es scheint ihnen zuerst, sie hätten für immer, aber sie sind kaum vierzig; da ist schon das letzte. Das hat natürlich seine Tragik. Sie sind nicht gewohnt, Gesichter zu schonen, ihr letztes ist in acht Tagen durch, hat Löcher, ist an vielen Stellen dünn wie Papier, und da kommt dann nach und nach die Unterlage heraus, das Nichtgesicht, und sie gehen damit herum. Aber die Frau, die Frau: sie war ganz in sich hineingefallen, vornüber in ihre Hände. Es war an der Ecke rue Notre-Dame-des-Champs. Ich fing an, leise zu gehen, sowie ich sie gesehen hatte. Wenn arme Leute nachdenken, soll man sie nicht stören. Vielleicht fällt es ihnen doch ein. Die Straße war zu leer, ihre Leere langweilte sich und zog mir den Schritt unter den Füßen weg und klappte mit ihm herum, drüben und da, wie mit einem Holzschuh. Die Frau erschrak und hob sich aus sich ab, zu schnell, zu heftig, so daß das Gesicht in den zwei Händen blieb. Ich konnte es darin liegen sehen, seine hohle Form. Es kostete mich unbeschreibliche Anstrengung, bei diesen Händen zu bleiben und nicht zu schauen, was sich aus ihnen abgerissen hatte. Mir graute, ein Gesicht von innen zu sehen, aber ich fürchtete mich doch noch viel mehr vor dem bloßen wunden Kopf ohne Gesicht. ICH fürchte mich. Gegen die Furcht muß man etwas tun, wenn mau sie einmal hat. Es wäre sehr häßlich, hier krank zu werden, und fiele es jemandem ein, mich ins H6tel-Dieu zu schaffen, so würde ich dort gewiß sterben. Dieses Hotel ist ein angenehmes Hotel, ungeheuer besucht. Man kann kaum die Fassade der Kathedrale von Paris betrachten ohne Gefahr, von einem der vielen Wagen, die so schnell wie möglich über den freien Plan dort hinein müssen, überfahren zu werden. Das sind kleine Omnibusse, die fortwährend läuten, und selbst der Herzog von Sagan müßte sein Gespann halten lassen, wenn so ein kleiner Sterbender es sich in den Kopf gesetzt hat, geradenwegs in Gottes Hotel zu wollen. Sterbende sind starrköpfig, und ganz Paris stockt, wenn Madame Legrand, brocanteuse aus der rue des Martyrs, nach einem gewissen Platz der Cité gefahren kommt. Es ist zu bemerken, daß diese verteufelten kleinen Wagen ungemein anregende Milchglastenster haben, hinter denen man sich die herrlichsten Agonien vorstellen kann; dafür genügt die Phantasie einer Concierge. Hat man noch mehr Einbildungskraft und schlägt sie nach anderen Richtungen hin, so sind die Vermutungen geradezu unbegrenzt. Aber ich habe auch offene Droschken ankommen sehen, Zeitdroschken mit aufgeklapptem Verdeck, die nach der üblichen Taxe fuhren: Zwei Francs für die Sterbestunde. DIESES ausgezeichnete H6tel ist sehr alt, schon zu König Chlodwigs Zeiten starb man darin in einigen Betten. Jetzt wird in 559 Betten gestorben. Natürlich fabrikmäßig. Bei so enormer Produktion ist der einzelne Tod nicht so gut ausgeführt, aber darauf kommt es auch nicht an. Die Masse macht es. Wer giebt heute noch etwas für einen gut ausgearbeiteten Tod? Niemand. Sogar die Reichen, die es sich doch leisten könnten, ausführlich zu sterben, fangen an, nachlässig und gleichgültig zu werden; der Wunsch, einen eigenen Tod zu haben, wird immer seltener. Eine Weile noch, und er wird ebenso selten sein wie ein eigenes Leben. Gott, das ist alles da. Man kommt, man findet ein Leben, fertig, man hat es nur anzuziehen. Man will gehen oder man ist dazu gezwungen: nun, keine Anstrengung: Voilä votre mort, monsieur. Man stirbt, wie es gerade kommt; man stirbt den Tod, der zu der Krankheit gehört, die man hat (denn seit man alle Krankheiten kennt, weiß man auch, daß die verschiedenen letalen Abschlüsse zu den Krankheiten gehören und nicht zu den Menschen; und der Kranke hat sozusagen nichts zu tun). In den Sanatorien, wo ja so gern und mit so viel Dankbarkeit gegen Ärzte und Schwestern gestorben wird, stirbt man einen von den an der Anstalt angestellten Toden; das wird gerne gesehen. Wenn man aber zu Hause stirbt, ist es natürlich, jenen höflichen Tod der guten Kreise zu wählen, mit dem gleichsam das Begräbnis erster Klasse schon anfängt und die ganze Folge seiner wunderschönen Gebräuche. Da stehen dann die Armen vor so einem Haus und sehen sich satt. Ihr Tod ist natürlich banal, ohne alle Umstände. Sie sind froh, wenn sie einen finden, der ungefähr paßt. Zu weit darf er sein: man wächst immer noch ein bißchen. Nur wenn er nicht zugeht über der Brust oder würgt, dann hat es seine Not. WENN ich nach Hause denke, wo nun niemand mehr ist, dann glaube ich, das muß früher anders gewesen sein. Früher wußte man (oder vielleicht man ahnte es), daß man den Tod in sich hatte wie die Frucht den Kern. Die Kinder hatten einen kleinen in sich und die Erwachsenen einen großen. Die Frauen hatten ihn im Schooß und die Männer in der Brust. Den hatte man, und das gab einem eine eigentümliche Würde und einen stillen Stolz. (…)
Heimatroman Ludwig Ganghofer (1855 – 1920) Waldrausch In ihrem ganzen Leben waren die zwei Kameraden noch nie so weit in die Welt hinausgekommen wie an diesem Morgen. Von ihrer Heimat war nur noch die Kirchturmspitze zu sehen, die nadelfein heraufragte über den blauträumenden, das ganze Tal durchquerenden Buchenwald. Die goldene Kugel auf dem grüngestengelten Kupferdach des Turmes blinkte in der Maisonne wie ein Stern, so fern, daß ihn keine Sehnsucht zu erreichen wagt. Dennoch wanderten die beiden Kameraden noch immer weiter hinaus in die fremde, wundersame Welt. Jede neue Bergzinne, die sich mit silbernen Schneefeldern heraushob über die steilen Wälder, war ihnen wie ein unerhörtes Ding, bei dessen Anblick man Herzklopfen bekommt. Sie standen und guckten. Und schritten weiter mit jenem Mute, der ein Nieerlebtes zu erleben hofft. Da tauchte hinter hohen Wälderwogen ein mächtiger Felskoloß heraus, schimmernd in der Sonne, so steil, daß kein Schnee mehr auf ihm haftete, und so kahl, daß man kaum noch eine bläuliche Schattenschrunde in der Steinwand zu erkennen vermochte. Tief atmend fragte der eine der beiden Knaben: »Tonele, wie heißt der Berg?" »Ich weiß nimmer. Der Vater selig hat mir's gsagt amal. Jetzt weiß ich's nimmer.« Sie spähten zu dem Berg hinauf, der wie eine steinerne Riesenfaust in das Blau des Himmels griff. Und der kleinere von den zweien, ein fünfjähriges Bürschl, sagte keck: »Da möchte ich hinauf einmal!« »Und tatst abifallen! Und tot sein.« »Du vielleicht! Ich tat hinaufkommen!« Dem siebenjährigen Tonele ging ein gutmütiges Lächeln um den weichen, roten Kindermund. Wie in freundlicher Barmherzigkeit sah er den kleinen Brosi an. Das war ein feines, zierliches Bübchen mit einem lichtblonden Ringelwust um das blühende Gesicht, in dem die blauen Augen sehnsüchtig strahlten. Die Füßchen und die runden Waden waren nackt, aber nicht so von der Sonne abgebrannt wie beim Tonele. Der trug außer dem kurzen, verwachsenen Lederhöschen nur ein Hemdl, das nimmer recht sauber war, während der kleine Brosi ein Gewand von städtischem Schnitt hatte. Pumphöschen und Bluse aus braunem Samt. Unter dem blonden Geringel war ein Matrosenkragen aus blau und weiß gestreiftem Leinen über die Schultern herausgelegt. Die Sonnenwänne lockerte das Blondhaar des Bübchens, so daß sich die wirren Ringeln immer leise bewegten. Die gespreizten Füße waren eingewühlt in den Staub der Straße. Immer spähte der kleine Kerl zu der steilen Felszinne hinauf. Dann entdeckte er in der Ferne des blühenden Wiesentales wieder ein geheimnisvolles Ding, das seinen Mut reizte. Dort schlössen die Berge das Tal, und mit sanften Wogen erhob sich ein Fichtenwald; schmale Sonnenbänder flössen über das Meer der Wipfel nieder; das war anzusehen, als wäre das Schattenblau von schimmerig gezahnten Goldborten durchzogen. Flüsternd sagte der kleine Brosi: »Tonele! Da geh ich hinein. In den tiefen, dunklen Wald!« Auch dem Tonele brannte ein neugieriger Durst in den nußbraunen Augen. Sein schlankes, kräftiges Körperchen streckte sich, als wäre auch in ihm der Wille zu einer kühnen Tat erwacht. Gleich aber huschte ihm wieder jenes gutmütige Lächeln über das sonnverbrannte Gesicht. Halb mahnend, halb scherzend sagte er: »Brösle! Das sollst lieber bleiben lassen. In dem tiefen, finsteren Wald, da fressen dich die Fuchs.« Brosi blickte nachdenklich gegen den Wald mit den goldleuchtenden Wipfeln hinaus. Trotziger Eigensinn erwachte in seinen großgeöffneten blauen Augen. »Wenn du dich fürchten tust, so geh halt heim! Ich geh in den finstern Wald hinein. Ich tu's!« Er schloß die Händchen zu Fäusten und wanderte mutig die sonnige Straße hin, dem gefährlichen Wald entgegen, der mit seinem samtdunkeln, glanzgebänderten Grün im Dufte des Vormittags lag, wie das Leben mit seinen geheimnisvollen Schatten und lockenden Helligkeiten vor dem Blicke aller Jugend liegt. Der Tonele besann sich ein bißchen, schob lächelnd die Hände in die Taschen seines Lederhöschens und ging gemütlich hinter dem Brosi her. Es war bis zu dem dunkeln, tiefen Wald kein allzu weiter Weg. Ein Mann mit gutem Schritt hätte den Forst in einem Viertelstündchen erreicht. Aber auf das Maß eines festen Männerschrittes kamen drei hurtige Zappelschrittlein des Brosi. Noch ehe der Weg zur Hälfte durchschritten war, mahnte der Tonele herzlich: »Geh, sei gscheit! Wir sind schon endsweit von daheim. Da kommst nimmer recht zum Essen. Und dein Mutterl wird schelten.« Brosi schüttelte das blonde Köpfl. »Die hat noch nie gescholten.« Er zappelte in der Sonne weiter. (…)
Historischer Roman (Gelehrtenroman)
Felix Dahn ( 1834 – 1912) Kampf um Rom (1876) »Dietericus de Berne, de quo cantant rustici usque hodie." ERSTES BUCH - THEODERICH - ERSTES KAPITEL Es war eine schwüle Sommernacht des Jahres fünfhundertsechsundzwanzig nach Christus. Schwer lagerte dichtes Gewölk über der dunklen Fläche der Adria, deren Küsten und Gewässer zusammenflossen in unterscheidungslosem Dunkel: nur ferne Blitze warfen hier und da ein zuckendes Licht über das schweigende Ravenna. In ungleichen Pausen fegte der Wind durch die Steineichen und Pinien auf dem Höhenzug, welcher sich eine gute Strecke westlich von der Stadt erhebt, einst gekrönt von einem Tempel des Neptun, der schon damals halb zerfallen, heute bis auf dürftige Spuren verschwunden ist. Es war still auf dieser Waldhöhe; nur ein vom Sturm losgerissenes Felsstück polterte manchmal die steinigen Hänge hinunter und schlug zuletzt platschend in das sumpfige Wasser der Kanäle und Gräben, die den ganzen Kreis der Seefestung umgürteten. Oder in dem alten Tempel löste sich eine verwitterte Platte von dem getäfelten Dach der Decke und fiel zerspringend auf die Marmorstufen — Vorboten von dem drohenden Einsturz des ganzen Gebäudes. Aber dies unheimliche Geräusch schien nicht beachtet zu werden von einem Mann. der unbeweglich auf der zweithöchsten Stufe der Tempeltreppe saß, den Rücken an die höchste Stufe gelehnt, und schweigend und unverwandt in einer Richtung über die Höhe hinab nach der Stadt zu blickte. Lange saß er so: regungslos, aber sehnsüchtig wartend: er achtete es nicht, dass ihm der Wind die schweren Regentropfen, die einzeln zu fallen begannen, ins Gesicht schlug und ungestüm in dem mächtigen bis an den ehernen Gurt wallenden Bart wühlte, der fast die ganze breite Brust des alten Mannes mit glänzendem Silberweiß bedeckte. Endlich stand er auf und, schritt einige der Marmorstufen nieder: „Sie kommen", sagte er. Es wurde das Licht einer Fackel sichtbar, die sich rasch von der Stadt her dem Tempel näherte: man hörte schnelle, kräftige Schritte, und bald danach stiegen drei Männer die Stufen der Treppe herauf. „Heil, Meister Hildebrand, Hildungs Sohn!" rief der voranschreitende Fackelträger, der jüngste von ihnen, in gotischer Sprache mit auffallend melodischer Stimme, als er die lückenhafte Säulenreihe des Pronaos, der Vorhalle, erreichte. Er hob das Windlicht hoch empor — schöne, korinthische Erzarbeit am Stiel, durchsichtiges Elfenbein bildete den vierseitigen Schirm, und den gewölbten durchbrochenen Deckel — und steckte es in den Erzring, der die geborstene Mittelsäule zusammenhielt. Das weiße Licht fiel auf ein apollinisch schönes Antlitz mit lachenden, hellblauen Augen; mitten auf seiner Stirn teilte sich das lichtblonde Haar in zwei lang fließende Lockenwellen, die rechts und links bis auf seine Schultern wallten; Mund und Nase, fein, fast weich geschnitten, waren von vollendeter Form, ein leichter Anflug goldhellen Bartes deckte die freundlichen Lippen und das leicht gespaltene Kinn; er trug nur weiße Kleider; einen Kriegsmantel von feiner Wolle, durch eine goldne Spange in Greifengestalt auf der rechten Schulter festgehalten, und eine römische Tunika von weicher Seide, beide mit einem Goldreif durchwirkt: weiße Lederriemen festigten die Sandalen an den Füßen und reichten, kreuzweis geflochten, bis an die Knie; die nackten, glänzendweißen Arme umzirkten zwei breite Goldreife: und wie er, die Rechte um eine hohe Lanze geschlungen, die ihm zugleich als Stab und als Waffe diente, die Linke in die Hüfte gestemmt, ausruhend von dem Gang, zu seinen langsameren Weggenossen hinunterblickte, schien in den grauen Tempel eine jugendliche Göttergestalt aus seinen schönsten Tagen wieder eingekehrt. Der zweite der Ankömmlinge hatte, trotz einer allgemeinen Familienähnlichkeit, doch einen von dem Fackelträger völlig verschiedenen Ausdruck. Er war einige Jahre älter, sein Wuchs war derber und breiter — rief in den mächtigen Stiernacken hinab reichte das dicht und kurz gelockte braune Haar — und van fast riesenhafter Höhe und Stärke: in seinem Gesicht fehlte jener rosige Schimmer, jene vertrauende Freude und Lebenshoffnung, welche die Züge des jüngeren Bruders verklärten: statt dessen lag in seiner ganzen Erscheinung der Ausdruck von bärenhafter Kraft und bärenhartem Mut: er trug eine zottige Wolfsschur, deren Rachen, wie eine Kapuze, sein Haupt umhüllte, ein schlichtes Wollenwams darunter, und auf der rechten Schulter eine kurze, wuchtige Keule aus dem harten Holz einer Eichenwurzel. Bedächtigen Schrittes folgte der dritte, ein mittelgroßer Mann von gemessen verständigem Ausdruck. Er trug den Stahlhelm, das Schwert und den braunen Kriegsmantel des gotischen Fußvolks. Sein schlichtes, hellbraunes Haar war über der Stirn geradlinig abgeschnitten: eine uralte germanische Haartracht, die schon auf römischen Siegessäulen erscheint und sich bei dem deutschen Bauer bis heut erhalten hat. Aus den regelmäßigen Zügen des offenen Gesichts, aus dem grauen, sichern Auge sprach besonnene Männlichkeit und nüchterne Ruhe. Als auch er die Cella des Tempels erreicht und den Alten begrüßt hatte, rief der Fackelträger mit lebhafter Stimme: „Nun, Meister Hildebrand, ein schönes Abenteuer muss es sein, zu dem du uns in solch unwirtlicher Nacht in die Wildnis von Natur und Kunst geladen hast! Sprich — was soll's geben?" Statt der Antwort fragte der Alte, sich zu dem Letztgekommenen wendend: „Wo bleibt der vierte, den ich lud?" „Er wollte allein gehen. Er wies uns alle ab. Du kennst ja seine Weise." „Da kommt er!" rief der schöne Jüngling, nach einer ändern Seite des Hügels deutend. Wirklich nahte dorther ein Mann von höchst eigenartiger Erscheinung. Das volle Licht der Fackel beleuchtete ein geisterhaft bleiches Antlitz, das fast blutleer schien; lange, glänzend schwarze Locken hingen von dem unbedeckten Haupt wie dunkle Schlangen wirr bis auf die Schultern. Hochgeschweifte, schwarze Brauen und lange Wimpern beschatteten die großen melancholischen dunkeln Augen voll verhaltner Glut, eine Adlernase senkte sich sehr scharfgeschnitten gegen den feinen, glattgeschorenen Mund, den ein Zug resignierten Grames umfurchte. Gestalt und Haltung waren so jugendlich: aber die Seele schien vor der Zeit vom Schmerz gereift. Er trug Ringpanzer und Beinschienen von schwarzem Erz, und in seiner Rechten blitzte ein Schlachtbeil an langem lanzengleichem Schaft. Nur mit dem Haupte nickend, begrüßte er die andern und stellte sich hinter den Alten, der sie nun alle vier dicht an die Säule, welche die Fackel trug, treten hieß und mit gedämpfter Stimme begann: „Ich habe euch hierher beschieden, weil ernste Worte müssen gesprochen werden, unbelauscht, und zu treuen Männern, die da helfen mögen. Ich sah umher im ganzen Volk, mondenlang: — euch hab' ich gewählt, ihr seid die Rechten. Wenn ihr mich angehört habt, so fühlt ihr von selbst, daß ihr schweigen müßt von dieser Nacht." Der dritte, der mit dem Stahlhelm, sah den Alten mit ernsten Augen an; „Rede", sagte er ruhig, „wir hören und schweigen. Wovon willst du zu uns sprechen?" „Von unserm Volk, von diesem Reich der Goten, das hart am Abgrund steht." „Am Abgrund?" rief lebhaft der blonde Jüngling. Sein riesiger Bruder lächelte und erhob aufhorchend das Haupt. „Ja, am Abgrund", rief der Alte, „und ihr allein, ihr könnt es halten und retten." * Kriegsroman: Erich Maria Remarque (1898 - 1970) Im Westen nichts Neues (1929) - Ich Erzähler im Ersten Weltkrieg
Aufsatzform Analyse und Textproduktion: Heinrich Böll (1917 - 1985) : Der Zug war pünktlich (Erzählung, 1949) Er-Erzähler im Zweiten Weltkrieg
Schlüsselroman Günter Grass (* 1927) Das Treffen in Telgte (Schlüssel - Erzählung auf die Gruppe ’47) 1979
Franziska zu Reventlow (1871 – 1918) Herrn Dames Aufzeichnungen oder Begebenheiten aus einem merkwürdigen Stadtteil 1 1913 (Tagebuchroman)
Verehrter Freund und Gönner! Sie wissen ja - Sie wissen genug darüber, wer »Wir« sind - womit wir uns unterhalten und mit welchem Inhalt wir die uns zugemessenen Erdentage zu erfüllen suchen. Sie wissen auch, wie wir das Dasein je nachdem als ernste und schwerwiegende Sache - als heiteren Zeitvertreib, als absoluten Stumpfsinn oder auch als recht schlechten Scherz hinzunehmen, aufzufassen und zu gestalten pflegen. Sie waren es, der von jeher das richtige Verständnis für unseren Plural hatte - für die große Vereinfachung und anderseits die ungeheure Bereicherung des Lebens, die wir ihm verdanken. Wie armselig, wie vereinzelt, wie prätentiös und peinlich unterstrichen steht das erzählende oder erlebende »Ich« da — wie reich und stark dagegen das »Wir«. Wir können in dem, was um uns ist, irgendwie aufgehen. untergehen — harmonisch damit verschmelzen. Ich springe immer wieder heraus, schnellt wieder empor, wie die kleiner Teufel in Holzschachteln, die man auf dem Jahrmarkt kauft. Immer strebt es nach Zusammenhängen — und findet sie nicht. Wir brauchen keinen Zusammenhang - wir sind selbst einer. Die Sendung, die wir heute unserem Briefe beifügen, oder richtiger, der Inhalt eben dieser Sendung ist wieder ein neue) Beweis dafür. Denn dies alles, teurer Freund, den wir insgesamt gleich schätzen und verehren, gilt nur als Vorrede einer Vorrede die jetzt beginnen und Ihnen zur Erläuterung beifolgende) Dokumente dienen soll, das heißt zur Erläuterung des Umstandes, dass wir eben diese Dokumente in Ihre Hände legen und von Ihnen die Lösung manches Rätsels erhoffen. Mit den Papieren hat es nun folgende Bewandtnis: Es mag etwa dreiviertel Jahr her sein, dass wir gelegentlich einer Seereise einen jungen Menschen kennen lernten. Wir fanden ihn sehr liebenswürdig und unterhielten uns gerne mit ihm. Es dauerte allerdings einige Zeit, bis es so weit kam, denn er war zu Anfang ungemein zurückhaltend und schien schwere seelische Erschütterungen durchgemacht zu haben -aber davon später. Der junge Mann hieß mit dem Nachnamen: Dame – also Herr Dame. Dieser Umstand mochte wohl einiges zu seiner reservierten Haltung beitragen und gehörte zu den vielen Hemmungen, über die er sich beklagte. Wenn er sich vorstellte oder vorstellen ließ, wurde er stets etwas unsicher und fügte jedesmal hinzu: »Dame, ja - ich heiße nämlich Dame. « Wir fragten ihn einmal, weshalb er das täte - der Name sei doch nicht auffallender als viele andere, und er mache auf diese Weise eigentlich die Leute selbst erst aufmerksam, dass sich eine Seltsamkeit, sozusagen eine Art Naturspiel daraus konstruieren lasse. Er entgegnete trübe: Ja, das wisse er wohl, aber er könne nicht anders, und es gehöre nun einmal zu seiner Biographie. (Diese Bemerkung lernten wir erst später bei der Lektüre seiner Aufzeichnungen verstehen.) Herr Dame war seinem Äußeren und seinem Wesen nach durchaus der Typus junger Mann aus guter Familie und von sorgfältiger Erziehung mit einer Beimischung von mattem Lebemannstum - sehr matt und sehr äußerlich. Er wäre nie ohne einwandfreie Bügelfalte auf die Straße gegangen, auch wenn ihm das Herz noch so weh tat - und das Herz muss ihm wohl oft sehr weh getan haben. Die Grundnote seines Wesens war überhaupt eine gewisse betrübte Nachdenklichkeit oder nachdenkliche Trübsal, aber daneben liebte er Parfüms und schöne Taschentücher. Als wir ihn kennen lernten, war er schweigsam und verstört; allmählich, besonders, wenn wir in den warmen Nächten an Deck saßen, ging ihm immer das Herz auf, und er erzählte von sich selbst und von seiner Biographie - wie er längere Zeit unter eigentümlichen Menschen gelebt und eigentümliche Dinge mit angesehen und auch miterlebt habe. Schon von Haus aus habe er einen dunklen Trieb in sich gefühlt, das Leben zu begreifen, und da habe man ihn an jene Menschen gewiesen. Leider vergeblich, denn er konnte es nun erst recht nicht begreifen, sondern sei völlig verwirrt geworden und eben jetzt auf dem Wege, in fernen Ländern Heilung und Genesen zu suchen. Den Ort, wo sich das alles begeben hat, wollte er nicht gerne näher bezeichnen — er sagte nur, es sei nicht eigentlich eine Stadt, sondern vielmehr ein Stadtteil gewesen, der auch in seinen Papieren oft und viel genannt wird. Wir konnten uns das nicht recht vorstellen. Er erzählte uns denn auch, dass er damals allerhand niedergeschrieben habe, in der Absicht, vielleicht später einen Roman oder ein Memoirenwerk daraus zu gestalten, und wir interessierten uns lebhaft dafür. So kam die Zeit heran, wo wir uns trennen mussten, denn die Reise ging zu Ende. An einem der letzten Tage stieg Herr Dame müden Schrittes in seine Kabine hinab und kam mit einem ansehnlichen Paket beschriebener Hefte wieder; dann sagte er, wenn es uns Freude mache, sei er gerne bereit, uns seine Aufzeichnungen zu überlassen. Er wolle sie auch nicht wieder haben, denn das alles sei für ihn abgetan und läge hinter ihm, und er habe wenig Platz in seinen Koffern. Was damit geschehe, sei ihm ganz gleichgültig, wir möchten es je nachdem weitergeben, verschenken, vernichten oder veröffentlichen. Er selbst würde schwerlich wieder nach Europa oder gar in jenen Stadtteil zurückkehren. Dann nahmen wir recht bewegt Abschied und wünschten ihm alles Gute. Unser Wunsch sollte leider nicht in Erfüllung gehen, denn der Zug, mit dem er weiterfuhr, fiel einer Katastrophe zum Opfer, und in der Liste der Geretteten war sein Name nicht genannt – so ist wohl anzunehmen, dass er mit verunglückte. Wir haben denn auch nichts mehr von ihm gehört. Die Aufzeichnungen haben wir gelesen - es war das erste, was wir damit taten; aber, wie schon anfangs erwähnt, vieles darin ist uns ziemlich dunkel geblieben. Nach unserer Ansicht handelt es sich, wie ja auch Herr Dame selbst meinte, um recht eigentümliche Menschen, Begebnisse und Anschauungen. — Unter anderem interessiert es uns lebhaft, wo jener Stadtteil zu finden ist, in dem sich das alles begeben. Wir leben, wie Sie wissen, schon so lange in der Fremde, dass es viel 2u anstrengend wäre, die Kultur-strömungen einzelner Stadtteile genauer zu verfolgen. Vor allem wünschen wir Ihre Ansicht darüber zu erfahren, ob die vorliegenden Dokumente wohl die Bedeutung eines „document humain“ haben und sich zur Veröffentlichung eignen würden. Meinen Sie nicht auch, dass es dann vielleicht ein schöner Akt der Pietät wäre, dem anscheinend Frühverblichenen auf diese Weise einen Grabstein zu setzen? Wenn Sie es für geboten erachten, würden wir Sie bitten, einen Kommentar dazu zu schreiben - uns fehlt leider die nötige Sachkenntnis, und so haben wir uns auf einige bescheidene und mehr sachliche Anmerkungen beschränkt – aber vielleicht ist es auch überflüssig. Kurzum - ja, wirklich kurzum, denn wir lieben die Kürze auch dann noch, wenn wir ausführlich sein müssen, lieben sie um so mehr, wenn wir gerade ausführlich gewesen sind - wir legen diese Papiere und alles Weitere vertrauensvoll in Ihre Hände. 1 Dezember Langweilig - diese Wintertage ... Ich habe nach Hause geschrieben und ein paar offizielle Besuche gemacht. Man nahm mich überall liebenswürdig auf und stellte die obligaten Fragen - wo ich wohne, wie ich mir mein Leben einzurichten gedenke und was ich studiere. Der alte Hofrat schien es etwas bedenklich zu finden, dass ich kein bestimmtes Studium ergreifen will und so wenig fixierte Interessen habe - ich solle mich vorsehen, nicht in schlechte Gesellschaft zu geraten. Das war sicher sehr wohlgemeint, aber es fällt mir auf die Nerven, wenn die Leute glauben, ich sei nur hier, um mir »die Hörner abzulaufen« und mich nebenbei auf irgendeinen Beruf vorzubereiten. Es war eine Erholung, nachher Dr. Gerhard im Cafe zu treffen. Ich erzählte ihm von meinen Familienbesuchen, er räusperte sich ein paarmal und sah mich prüfend an. Dann meinte er, das mit dem Hörnerablaufen sei wohl eine veraltete studentische Schablone, aber es gäbe neuerdings eine ganze Anzahl junger Leute, die sich »gärenshalber« hier aufhielten, und zu diesen würde wohl auch ich zu rechnen sein. Eine sonderbare Definition - »gärenshalber« - aber der Doktor drückt sich gerne etwas gewunden aus . . . das scheint überhaupt hier üblich zu sein. Wenn man darüber nachdenkt, hat er eigentlich nicht ganz Unrecht. Vielleicht ist etwas Wahres daran—es kommt mir ganz plausibel vor, dass mein Stiefvater mich gärenshalber hergeschickt hat. Nur passt es wohl gerade auf mich nicht recht. Ich habe keine Tendenzen zum Gären und auch gar kein Verlangen danach — überhaupt nicht viel eigne Initiative — ich werde einfach zu irgend etwas verurteilt, und das geschieht dann mit mir. Mein Stiefvater meint es sehr gut und hat viel Verständnis für meine Veranlagung; so pflege ich im großen und ganzen auch immer zu tun, was er über mich verhängt. Verhängt - ja, das ist wohl das richtige Wort. Schon allein die äußeren Umstände bringen es mit sich, dass immer alles eine Art Verhängnis für mich wird. Zum Beispiel in erster Linie mein Name und meine Väter. Meinen richtigen Vater habe ich kaum gekannt — er soll sehr unsympathisch gewesen sein - und nur den Namen von ihm bekommen. Mein Stiefvater hat einen normalen, unauffälligen Namen und war eigentlich die erste Liebe meiner Mutter. Sie hätte ihn ebenso gut gleich heiraten können, und alles wäre vermieden worden. Es wurde aber nicht vermieden, denn es war über mich verhängt, diesen Namen zu bekommen und mein Leben lang mit ihm herumzulaufen. Dame - Herr Dame - wie kann man Herr Dame heißen? so fragen die anderen, und so habe ich selbst gefragt, bis ich die Antwort fand: Ich bin eben dazu verurteilt, und der Name verurteilt mich weiter zu allem möglichen - zum Beispiel zu einer ganz bestimmten Art von Lebensführung - einem matten, neutralen Auftreten, das mich irgendwie motiviert. Dissonanzen kann ich nun einmal nicht vertragen, und das Matte, Neutrale liegt wohl auch in meiner Natur. Ich habe es nur allmählich noch mehr herausgearbeitet und richtig betonen gelernt. Über das alles habe ich mit Dr. Gerhard ausführlich gesprochen, er schien es auch zu verstehen, und es interessierte ihn. Der »Verurteilte« sei wohl ein Typus, meinte er, mit derselben Berechtigung, wie »der Verschwender«, »der Don Juan«, »der Abenteurer« und so weiter als feststehende Typen betrachtet würden. Dann hat er gesagt, jeder Mensch habe nun einmal seine Biographie, der er nachleben müsse. Es käme nur darauf an, das richtig zu verstehen - man müsse selbst fühlen, was in die Biographie hinein-gehört und sich ihr anpasst- alles andere solle man ja beiseite lassen oder vermeiden. 7. Dezember Darüber habe ich dieser Tage viel nachgedacht. Heute hätte ich gerne wieder Dr. Gerhard getroffen und das neuliche Gespräch mit ihm fortgesetzt. Aber es saß diesmal eine ganze Gesellschaft mit am Tisch. Unangenehm, dass man beim Vorstellen nie die Namen versteht — das heißt, meinen haben sie natürlich alle verstanden - mein Verhängnis – er ist so deutlich und bleibt haften, weil man sich über ihn wundert. Ich habe diese junge Frau beneidet, die neben Gerhard saß, weil man sie nur Susanna oder gnädige Frau anredete. Du lieber Gott, ich werde ja nicht einmal heiraten können, wenn ich gerne wollte. Wie könnte man einem Mädchen zumuten, Frau Dame zu heißen ? Und dann daneben zu sitzen, das mit anzuhören und selbst . . . nein, diese Reihe von Unmöglichkeiten ist nicht auszudenken. (…) Man hat sich dann sehr lebhaft unterhalten. Ich konnte manchmal nicht recht folgen - Doktor Sendt merkte es jedesmal, zog dann die Augenbrauen in die Höhe, sah mich mit seinen scharfen hellblauen Augen an und erklärte mir in klarer, pointierter Ausdrucksweise, um was es sich handle. Ich möchte gerne mehr mit ihm verkehren; mir ist, als könnte ich viel von ihm lernen. Und eben das scheint mir hier eine zwingende Notwendigkeit. Zuletzt sprachen sie viel von einem literarischen Kreise, um den es etwas ganz Besonderes sein muss. Dabei entspannen sich starke Meinungsverschiedenheiten. Bei diesem Gespräch hörte ich nur zu, ich mochte nicht immer wieder Fragen stellen, um so mehr, weil allerhand Persönliches berührt wurde und ich nicht .gerne indiskret erscheinen wollte. Übrigens genierte ich mich auch etwas, weil der Dichter, der den Mittelpunkt jenes Kreises bilden soll, mir ziemlich unbekannt war. Seinen Namen kannte ich wohl, aber von seinen Werken so gut wie nichts. (…) 1 gemeint: der Münchener Stadtteil Schwabing
Utopie-Roman: J. G. Schnabel (1692 - 1750 ?) : Insel Felsenburg s. Ich-Erzähler und Robinsonaden Joachim Heinrich Campe (1746 – 1818) Robinson der Jüngere s. Abenteuerroman
Kein copyright: Alfred Döblin ( 1878 – 1957): Berge, Meere und Giganten (1924) Hans Dominik (1872 – 1945) : Atlantis (1924) Franz Werfel ( 1890 – 1945): Stern der Ungeborenen (1946)
|
|
|